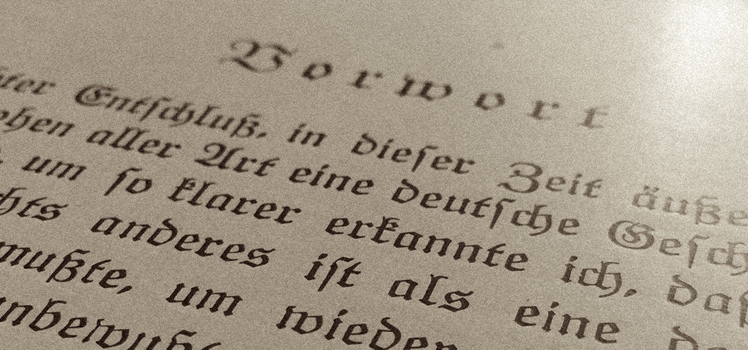
Da ich ein Buch möglichst unvoreingenommen lesen möchte, vermeide ich es, im Vorfeld zu viel über den Inhalt zu erfahren. Daher lese ich Vorworte prinzipiell immer zuletzt. Und in einigen Fällen lese ich sie gar nicht.
Ich würde sogar behaupten, dass die meisten Vorworte schlichtweg überflüssig sind. Oft sind es mehr oder minder amüsante Lobhudeleien, die von einem prominenten Freund des Verfassers fabriziert wurden, der vom Verlag in die Rolle des Lobreden-Schreibers hineingedrängt worden ist. Natürlich gibt es auch gewohnheitsmäßige Laudatoren, wie beispielsweise den verstorbenen Hellmuth Karasek, der die Kunst beherrschte, ganze Seiten zu füllen, ohne nennenswerte eigene Erkenntnisse zu offenbaren. Aber der Inhalt ist in so einem Fall ohnehin nebensächlich. Wichtig ist, dass der Verlag den Namen des prominenten Lobredners werbewirksam auf dem Cover platzieren kann.
Unschöne Erfahrungen auf dem Gebiet der Promi-Präambel machte der amerikanische Verlag Fantagraphics. Als man dort das Sachbuch »How To Read Nancy« herausbrachte, wollte man dem Leser neben einer sachlichen Einleitung von Professor James Elkins etwas wirklich Gegensätzliches bieten. Und was wäre Gegensätzlicher als Comedy-Urgestein Jerry Lewis?
Lewis erklärte sich sofort bereit und versprach innerhalb einer Woche ein Vorwort zu liefern. Als das Vorwort nach einem halben Jahr schließlich kam, bestand es aus sechs Sätzen (jedoch in Großbuchstaben), in denen Lewis erklärte, das Buch nicht gelesen zu haben, er aber sicher sei, dass es »QUALITY READING« bot. Nachdem der verzweifelte Lektor die Sekretärin des Altstars mit Blumen und einem Glas selbstgemachter Marmelade bestach, konnte man Lewis schließlich ein neues, etwas ernsthafteres Vorwort, das immerhin vier vollständige Sätze umfasste, abringen.
Natürlich gibt es auch Experten, die ganze Karrieren mit den Verfassen von Vorworten bestreiten. Die meisten bemühen sich, das Buch oder den Autor zu erklären. Niemand würde auf die Idee kommen, in einem Kunstmuseum unter jedem Exponat eine Interpretation anzubringen. Das käme einer Beleidigung des Betrachters gleich. Bei Büchern ist das anders. Besonders wenn der Verfasser das Zeitliche gesegnet hat, werden solche Interpretationen geradezu abenteuerlich.
Ist der ganze Roman nicht die Verarbeitung einer unglücklichen Ehe? Und hat die Schurkin der Geschichte nicht eine auffällige Ähnlichkeit mit der ungeliebten Schwippschwägerin des Verfassers? In den meisten Fällen möchte der Verlag dem Buchkäufer wohl nur das schöne Gefühl geben, etwas ganz Besonderes in den Händen zu halten – was etwa einer literarischen Fortsetzung der Customer Reassurance entspricht. Obwohl es natürlich auch viele Menschen gibt, die gern alles mundgerecht vorgekaut haben möchten.
Es ist jedoch nicht alles schlecht. In der Kurzgeschichtensammlung »Fliegenpapier« von Dashiell Hammett schrieb dessen ehemalige Lebensgefährtin Lillian Hellman ein beispielhaftes Vorwort, in dem sie Hammetts Leben und Werk weder zerredet noch zu Tode analysiert. Der Mythos, der den legendären Krimischreiber heute umgibt, basiert auf diesem Text. Doch auch hier gab es Kritiker, die Hellman romantisierende Geschichtsverfälschung vorwarfen.
Einige Autoren schreiben daher ihre Vorworte lieber selbst, denn nur so kann man als Künstler wirklich sicher sein, nicht missverstanden zu werden (und hat zudem die Chance, an der eigenen Legende zu stricken). Harlan Ellison ist in dieser Disziplin wohl der Platzhirsch. Jede seiner Kurzgeschichten wird von einem Vorwort eingeleitet, das manchmal länger ist als die Geschichte selbst. Die meisten dieser Einleitungen sind jedoch so amüsant, dass man davon eigentlich eine Sammlung herausbringen müsste … eingeleitet natürlich von einem Vorwort.

