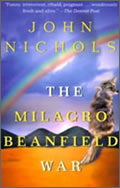 It’s always darkest before the dawn.
It’s always darkest before the dawn.
John Nichols erzählt in »The Milagro Beanfield War« (1974) die Geschichte eines kleinen Dorfes im Südwesten der USA, in dem sich an einem unerlaubt bewässerten Bohnenfeld der Kampf arm gegen reich entzündet. Jahrelang wurden in Milagro dem ärmeren Teil der Bevölkerung, vor allem den Angehörigen der Chicano Kultur, durch undurchsichtige Gesetze, Regelungen und Verträge nach und nach Wasserrechte, Land und Lebensgrundlage genommen, während einige wenige mit dem Tourismus in der Gegend gute Geschäfte machten. Bis schließlich Joe Mondragon eines Tages (es muss Anfang der 1970er sein) aus einem Impuls heraus beschließt, sein Bohnenfeld zu bewässern, indem er einen Graben anzapft.
Gegen seinen Willen wird es zu einem symbolischen, repräsentativen Akt. Vergleiche zu Steinbecks »Die Früchte des Zorns« sind berechtigt, aber Nichols erzählt mehr als nur die Geschichte, wie die Armen so weit getrieben werden, dass sie sich zusammenschließen und zur Wehr setzen. Bei Nichols bleibt die gegnerische Seite, die Reichen und Mächtigen, nicht so gesichtslos und anonym wie bei Steinbeck. Er beschreibt beide Seiten mit Fairness, so dass die Motivation aller nachvollziehbar wird. Niemand ist grundlos böse in diesem Buch, und umgekehrt sind seine Armen keine Heiligen. Nichols zeichnet seine Charaktere oft mit einer meisterhaften Satire, ohne jemals kaltherzig zu werden oder in schwarz-weiß Malerei abzudriften.
In »The Milagro Beanfield War« findet der Leser einen Reichtum an liebenswerten und interessanten Charakteren, stets mit ausführlichen Hintergrundanekdoten ausgestattet und in eine Geschichte verwickelt, die den Leser immer mehr in ihren Bann zieht.
Aber es geht noch um mehr in diesem Buch. Nichols zeigt mit analytischer Schärfe und gleichzeitig mit wundervoller Komik (man muss beim Lesen nicht selten laut auflachen), wie Gewalt entstehen kann, ohne dass es eigentlich jemand der Beteiligten will, wie Waffenbesitz Gewalt zum Ausbruch bringen oder gerade dies verhindern kann.
Auch das Phänomen, dass Leute, die sich eigentlich lieben, gelegentlich das Bedürfnis verspüren, sich gegenseitig zu verletzen, spielt eine Rolle. Manchmal, um Aggressionen aus anderen Quellen einfach dort auszulassen, wo sie können; manchmal aber auch aus dunkleren, undurchsichtigeren Gründen.
Viele Leute in diesem Buch können nicht miteinander reden, obwohl sie es wollen. Vielleicht hat aber auch die menschliche Spezies keine geeignete Zielscheibe mehr für die kämpferischen Triebe, die sie seit den Frühphasen der Evolution in ihren Genen mit sich herumträgt. Dass das Leben ein nie endender Kampf ist, wird nicht nur durch die Rückblicke auf andere Auseinandersetzungen verdeutlicht, sondern kommt wie bei Steinbeck in den vielen ganz nebenbei auf der Strecke bleibenden Tieren zum Ausdruck – hier ein unabsichtlich erdrückter Vogel, dort ein zertretener Wurm.
Wie in vielen Büchern der amerikanischen Literatur steht im Hintergrund das Problem der Freiheit des Einzelnen, die dadurch eingeschränkt wird, dass zu viele Leute auf einem Fleck leben. Die deswegen erforderliche Regierung muss nicht einmal mit Mitteln arbeiten, die nicht immer integer sind, um sich unliebsam zu machen – nein, sie ist es schon, weil sie das aus der Besiedelungszeit des Westens gewohnte Leben in vollkommener Freiheit zunichte macht, ein Leben, in dem es noch keine Steuern und Personalausweise zu geben schien, eine Zeit, in der der Mensch noch nicht als ein Haufen bürokratischer Daten irgendwo erfasst war. Eine derartige Vergangenheit, in der auch die Natur noch reiner war, wird oftmals evoziert, aber nie schöngefärbt. Die älteren Charaktere untergraben ihre nostalgischen Erinnerungen meistens mit dem Zusatz:
And what had been so great about the old days anyway? You couldn’t read or write and half the people died of TB.
Trotzdem wird die Entwicklung Amerikas und der Menschheit, vor allem ihre umweltzerstörerischen und sozial ungerechten Aspekte, in Nichols Roman bedauert und wegen ihrer scheinbaren Unaufhaltsamkeit als unheimlich empfunden. Und doch wird nie vollkommen die Hoffnung zunichte gemacht, dass eine Umkehr doch noch möglich ist, und sich – wenn auch nur im Kleinen – Dinge ausnahmsweise auch einmal zum Guten wenden können, denn:
It’s an ill wind that blows no good.
John Nichols: The Milagro Beanfield War | Englisch
Henry Holt & Company 2000 | 464 Seiten | Nur noch antiquarisch erhältlich

