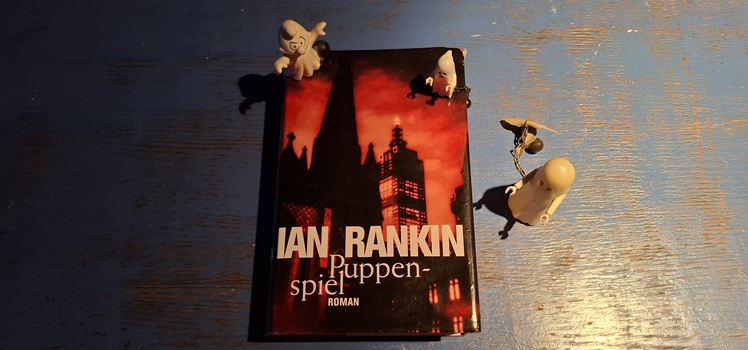
Wenn man von einem Autor zum ersten Mal in dessen Stammkneipe erfährt, legt man sich daheim aus Neugier mal ein Buch von ihm zu. Im Falle von Ian Rankin aus Edinburgh fiel dies erschütternd langweilig aus, na gut, gibt’s halt eine zweite Chance: Das 2002 auf Deutsch erschienene »Puppenspiel« aus der Reihe um Rankins Inspektor John Rebus soll’s richten, schafft dies aber auch nicht. Eine in den Grundzügen interessante Geschichte bekommt eine Ausdehnung auf über 600 Seiten, gestreckt mit entsetzlicher Langeweile.
Hier ist die Art, wie ich 2019 erstmals von Ian Rankin hörte, spannender als das Buch: Anfang der Nuller ersteigerte ich bei einem eBay-Nutzer eine CD nicht. Damals war Paypal noch nicht etabliert und waren US-Importe daher nahezu unerreichbar. Ich mailte deshalb den Verkäufer an, ob er das Album – von Les Claypools Fearless Flying Frog Brigade – zufällig nochmal im Bestand habe, und er antwortete, dass sein Schwager demnächst in die USA reisen würde und mir dieses und das zweite Album mitbringen könnte. Was auch geschah. Zum Austausch trafen sich der jüngst nach Hamburg verzogene Verkäufer Olli und ich uns in seiner Heimatstadt Celle und verabredeten aus dem Stand, dass wir uns kurz darauf in Hamburg zum Konzert der Band (!) treffen würden. Der Beginn einer Freundschaft, die 2019 darin mündete, dass Olli und ich zusammen nach Edinburgh reisten, weil wir im benachbarten Glasgow die neuseeländische Band Shihad sehen wollten. Olli aktivierte noch seinen Rugby-Freund Bill, der mit uns kommen würde und uns außerdem an den anderen Tagen durch Edinburghs Pubs schleuste. So auch ins Ox, die Oxford Bar, in der Bill uns offenbarte, sie sei das Stammpub von Ian Rankin. Von wem?
Mein erster Versuch mit dem Autor war »Die Kassandra Verschwörung«, nur echt ohne Bindestrich, das Rankin 1993 als »Witch Hunt« und unter dem Pseudonym Jack Harvey veröffentlicht hatte. Mehr, als dass es ein ausnehmend zähes Leseerlebnis war, blieb davon nicht hängen. Nun also als neuer Versuch der Gelegenheitsfund »Puppenspiel«, im Original »The Falls«, nach einem der Handlungsorte, von dem zu erwarten steht, dass es, da einige Jahre später verfasst, mögliche Anfängerschwächen überwunden habe. Hat es nicht, sondern sie vielmehr etabliert.
Ausgangslage ist, dass sich die Spur einer jungen Frau zwischen ihrem Zuhause und der Verabredung mit Freunden verliert und dass der stinkreiche Vater sofort die Polizei einschaltet, weil er ein Verbrechen wittert. Da sich aber wahrhaftig alle Spuren verloren haben und sich nicht mal ein Verbrechen überhaupt ausmachen lässt, treten die Ermittler auf der Stelle. Mit zwei Ausnahmen: Auf dem Laptop der Verschwundenen lassen sich wortwörtlich rätselhafte Emails rekonstruieren, die sie mit jemandem namens Quizmaster austauschte. Und im abgelegenen Heimatflecken der jungen Frau findet eine Künstlerin sofort einen kleinen Holzsarg mit einer Puppe darin, was den findigen Inspektor mit dem sprechenden Namen Rebus auf die Idee bringt, diesen Fall mit älteren Fällen von gefundenen Minisärgen und verschwundenen oder verstorbenen Frauen sowie mit einem Dutzend historischer Sargfunde in Verbindung zu bringen. Muss er wissen.
Das Buch ist über 600 Seiten dick. Es braucht 200 Seiten bis zum ersten Toten, und der stirbt eines natürlichen Todes. Erst nach 300 Seiten wird aus der orientierungslosen Vermisstensuche ein konkreter, aber kaum weniger orientierungsloser Mordfall. Der Rest dazwischen und danach sind Herumgeeiere, Herumgeassoziiere und Herumgejammere. Den Showdown reißt Rankin in nur zehn bis 20 Seiten ab, und das, obwohl es sich sogar noch um einen zweifachen handelt. Man könnte das Buch zusammenfassen mit dem Eintrag, der laut Douglas Adams im »Anhalter« unter dem Stichwort Erde zu finden ist: größtenteils harmlos.
Wir bewegen uns im Jahr 2001, als Mobiltelefone, Email und mobiles Internet noch nicht jedem zugängliche Zauberphänomene waren, und Rankin erweckt den Eindruck, als gehöre er selbst zu denen, die keinen Einblick in die Materie haben. Kostenlose Emails gibt es seit den Neunzigern, und er lässt die Polizisten sich wundern, dass der Absender wechselnde Adressen nutzt, ganz abgesehen davon, dass die Ermittler nicht mal selbst jeder einen Mailaccount haben. Emails, so lässt Rankin wissen, können, ähnlich wie Mobiltelefonnummern, nicht zurückverfolgt werden, weshalb die Kripoleute delirierend umhertaumeln, anstatt ihren Job zu machen. Später im Buch ist »der Geheimdienst« dann doch dazu in der Lage, Absender auszumachen, und man fragt sich, warum dieser Service nicht von Anfang an in Anspruch genommen wurde, schließlich drückt mit dem Vater der Verschwundenen ein einflussreicher Bänker auf die Tube. Aber irgendwie muss man ja auf 600 Seiten und trotzdem zum Ziel kommen.
Ähnlich mit spitzen Fingern schreibt Rankin über Subkulturen und Angehörige sozialer Randbereiche, als wären sie ihm selbst verschlossen, als sei er ein Fremdkörper in seiner eigenen Geschichte, anstatt dass er seine Leserschaft von mitten aus diesen Gesellschaften heraus mitnimmt. In D&D- und sonstige Rollenspieler mag er sich nicht hineinversetzen, und auch seine Ermittler lässt er wie Ochsen vorm Scheunentor agieren, sobald sie mit ungewöhnlichen Welten in Kontakt treten, obschon man davon ausgehen darf, dass insbesondere Kriminalpolizisten so ziemlich jeden Scheiß schon mal gesehen haben dürften.
So weltfremd tappen alle Beteiligten durch den Fall, der das halbe Buch über erstmal gar keiner ist. Immerhin finden sie Hilfe bei zwei externen Fachleuten, nämlich einem pensionierten Pathologen mit dem abermals halbwegs sprechenden Namen Devlin und einer Museumsmitarbeiterin, die dann gleich Rebus‘ neue Geliebte wird, wie praktisch. Ebenso entsetzlich praktisch ist die Rolle von Devlin, aber das sei hier erstmal nicht gespoilert.
Einerseits lässt sich Rankin seitenweise über Nebenthemen aus, etwa dem Umgang der Polizei mit der Presse, und offenbart aber gleichzeitig andererseits, dass er davon eigentlich doch nicht so recht die Ahnung haben kann, denn in der Realität dürften sich die Machtverhältnisse teilweise anders darstellen. Ebenso, sobald es zu Verhören kommt: Das Gestümper der Polizei ist erbärmlich, gleichermaßen abgebildet in vielen Dialogen, in denen eine Figur eine Erkenntnis mit einer anderen teilen will, um ein Ergebnis zu erzielen, und sich dann jedes Mal auf ein sinnloses Zerfasern des Gespräches einlässt, nur damit das Buch noch einige weitere hundert Seiten dauern darf.
So betulich stellt Rankin auch seinen Helden dar, der als Querkopf gilt, der ständig in Kneipen herumhängt und irrwitzigen Ideen folgt, die dann in der Regel auch noch zutreffen. Warum man ihm dann allmählich nicht gleich den richtigen Riecher zutraut und ihn ungebremst machen lässt, weiß der Autor, der dieses Konzept hier schließlich zum bereits zwölften Mal anwendet. In diesem Falle kramt Rebus nach Auffinden des ersten Mini-Sarges ganze vier vergleichbare Fälle aus den zurückliegenden 30 Jahren zusammen, die sich quer über ganz Schottland ereigneten und die trotzdem ganz ganz zufällig genau jetzt direkt in Rebus‘ Kreisen zusammenlaufen. Hat er doch wieder Recht gehabt, der Schlingel! Und auch nicht, denn der Quizmaster hat damit nix zu tun. Wie wird man nun dessen habhaft? Indem man sich als Polizistin auf sein Spiel einlässt und versucht, seine Rätsel zu lösen, anstatt ihn via Provider einzukreisen, natürlich.
Als Füllstoff dichtet Rankin allen Personen Biografien an. Allen. Ausführliche. Banale. Beliebige. Bis in die dritte Nebenebene. Insbesondere Rebus hat an »alten Geistern« zu knabbern, die er fortwährend in Alkohol zu ertränken versucht, übrigens seinerseits im Ox, muss ja. Da hat Henning Mankell echt was angerichtet, als er seinen Kurt Wallander ab 1991 in die Verzweiflung stürzte und einen Gescheiterte-Ermittler-Trend lostrat. Diesen Kniff wenden zwar unzählbare Autoren an, aber es gibt darunter auch einige, denen es gelingt, damit nicht zu langweilen, etwa Ben Aaronovitch mit seinem Peter Grant in »Die Flüsse von London« oder sogar Jussi Adler Olsen mit Carl Mørck in der »Sonderdezernat Q«-Reihe – möglicherweise greift bei Rankin die Kombination aus dem Eindruck von Fremdeln im eigenen Revier und seiner tiefgreifenden Humorbefreiung. Immerhin kennt er sich in seiner Heimatstadt ganz gut aus und lässt dies die Leserschaft auch dringendst wissen, indem er darüber weiteren Füllstoff einfließen lässt.
Kurioserweise generiert Rankin Situationen, die das Potenzial haben, spannend zu werden, brenzlig, knifflig – und lässt sie stets und immer in nichts verpuffen. Keine Action, keine Gefahr, nichts, nicht mal der Doppel-Showdown strahlt Bedrohlichkeit aus, zumal Rankin ihn auch so hoppladihopp abhandelt, als wolle er die Cosy-Leserschaft nicht in Alpträume stürzen. Stattdessen erfindet er Animositäten zwischen den Polizisten m/w/d, inklusive übergriffigem Knutschen und absurd schwachen Charakteren. Gossip statt Thrill.
Erzählerisch fußt einfach zu viel auf Zufällen: Die Särge der vier alten Fälle sind noch auffindbar, Akten dazu ebenfalls, und es gab tatsächlich nur diese exakt vier Fälle, die Rebus nur durch einen Geistesblitz überhaupt zusammenbringt, und nicht etwa noch unzählbare mehr, die die Behörden schlichtweg aufgrund ihrer Banalität gar nicht publik machten, nein, exakt vier, alle paar Jahre mal einer, und Rebus bringt sie nicht nur zusammen, sondern auch noch nach Jahrzehnten den Täter zur Strecke, von dem keiner ahnte, dass er existiert, weil man die Fälle nicht für Straftaten hielt, und dessen Motivation zu allem Übel nicht eben schlüssig ist. Und was war jetzt mit diesem deutschen Touristen?
Eine weitere erzählerische Schwäche ist es, dass Rankin vermeintlich folgenreiche Gedanken nicht ausformuliert, sondern mit drei Punkten andeutet. Zusätzliche sprachliche Merkwürdigkeiten dürften dem Übersetzer Christian Quatmann oder dem Verlag anzulasten sein: Rebus siezt hier seine neue Vorgesetzte, obwohl er mal was mit ihr hatte. Der Titel hat mit dem Inhalt nur am Rande zu tun. Und dann deutscht Quatmann englische Wörter ein, anstatt sie als feststehende Begriffe bei der Leserschaft als bekannt vorauszusetzen oder wenigstens zu erläutern, was den Eindruck verstärken würde, sich tatsächlich in Edinburgh zu bewegen und nicht in sarenwama Darmstadt. Jugendliche lässt er im Park »Apfelwein« aus Dosen trinken, darüber hätte sich Heinz Schenk sicherlich gefreut, nicht aber jeder, der ahnt, dass es sich dabei um Cider handeln müsste. Stets ist die Rede von Kneipen statt von Pubs, also bitte. D&D, also Dungeons & Dragons, übersetzt er allen Ernstes als »Drachen und Degen«. Wenn Rebus hingegen bei der Beerdigungsfloskel »Asche zu Asche« an David Bowie denken muss, wird nur denen, die dessen Song »Ashes To Ashes« kennen, der Zusammenhang klar. Die Rätseltexte hingegen lässt Quatmann auf Englisch, gottlob. Hier wird nicht so richtig klar, was der Verlag der Leserschaft zutraut und was nicht. Und – auf das Gälische Prost gehört ein Akut: »Sláinte«, das weiß jeder Touri.
Das mit der Popmusik ist ohnehin so ein Spleen von Rankin, der so gar nicht ins ansonsten so Betuliche passen will. Ständig lässt er die Figuren über Mucke quatschen und Rebus irgendwelche Platten auflegen. Ist ja nett, weil das auch in der Realität für manche Leute zum Alltag gehört, bleibt aber bis auf wenige Ausnahmen an einer gefälligen Oberfläche. Zumindest aus der Perspektive von Kontinentaleuropäern gibt es Ausnahmen, denn auf den Inseln sind Musiker, die hierzulande zum Untergrund gehören, bisweilen Mainstream, etwa Mark E. Smith oder Declan MacManus, nach dem Rankin ernsthaft eine der Figuren benennt, inklusive dem Hinweis, dass der ja heiße wie Elvis Costello in echt. Auch andere Namen schottischer Musiker tauchen hier auf, so heißt Rebus‘ neue Flamme mit Nachnamen Burchill, wie der Gitarrist der Glasgower Simple Minds.
Warum bleibt man dann trotzdem dran? Vermutlich, um herauszufinden, was es denn nun mit allem auf sich hat und wie es zur Lösung kommt. Aber das lohnt sich nur so bedingt. Ein wenig, weil man heute quasi in eine Art Technikmuseum blickt, in dem etwa die Rede von längst vergessenen WAP-Handys ist. Mag man sich gar nicht ausmalen, wie die anderen Fälle mit Rebus seit 1987 so sind. Mehr als solche verfasst Rankin ja kaum. Erst im vergangenen Jahr kam mit »Midnight And Blue« der 25. Rebus-Krimi heraus, in Deutschland indes noch nicht. Kleine Peinlichkeit zum Schluss: Auf den Buchrücken schrieb der Manhattan-Verlag seinerzeit »Von Englands Krimiautor Nr. 1«, was dem Schotten gehörig den Whisky aus dem Blut getrieben haben dürfte. Kann man ihn im Ox ja mal fragen.
Ian Rankin: Puppenspiel | Deutsch von Christian Quatmann
Goldmann 2004 | 640 Seiten | Jetzt bestellen

